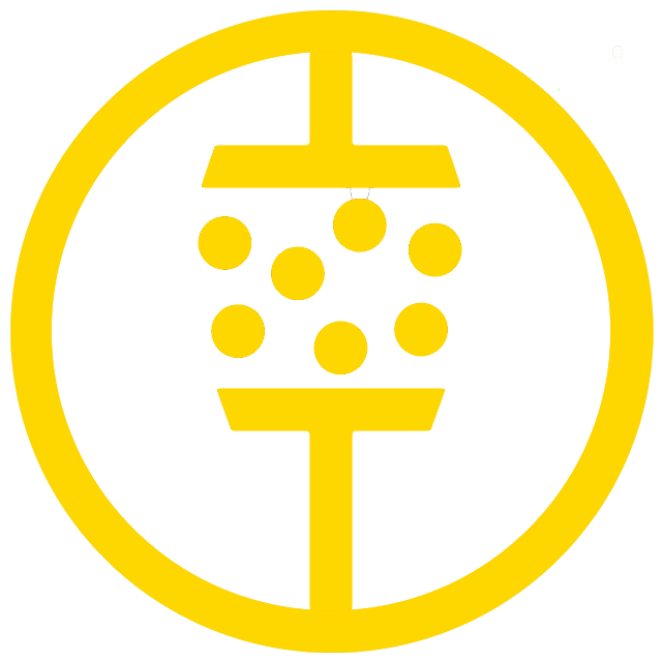Hier sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie mit dem Titel „Wenn die Parkinson-Krankheit das Leben eines Paares beeinträchtigt: Eine qualitative Studie” von Kathy Dujardin et al., die am 28. Oktober 2025 online veröffentlicht wurde.
Studienübersicht
- Die Studie verwendete eine qualitative Methodik (dyadische interpretative phänomenologische Analyse), um zu untersuchen, wie Paare damit umgehen, wenn ein Partner an Parkinson (PD) leidet.
- Insgesamt wurden 45 Paare befragt, die nach dem Fortschreiten der Krankheit in Gruppen eingeteilt wurden. Die Interviews wurden separat mit jedem Partner durchgeführt.
- Ziel war es, Folgendes zu verstehen:
- Die Erfahrungen des Paares im gemeinsamen Umgang mit PD und
- die Mechanismen, durch die sich die Paarbeziehung unter dem Einfluss von PD verändert.
Die wichtigsten Ergebnisse
Die Autoren identifizierten mehrere Mechanismen, die die Paardynamik beeinflussen; einige waren in allen Krankheitsstadien gleich, andere variierten mit dem Fortschreiten der Krankheit.
Mechanismen, die in allen Stadien gleich sind
Unabhängig davon, wie weit die Krankheit fortgeschritten war, kristallisierten sich drei Schlüsselthemen heraus:
- Unterschiedliche Ansichten über die Parkinson-Krankheit: Die Partner hatten oft unterschiedliche Sichtweisen auf die Krankheit (ihre Bedeutung, ihre Auswirkungen, den Umgang mit ihr), was zu Spannungen führen konnte.
- Zusammenhalt/Kohäsion: Viele Paare bemühten sich, ein Team zu bleiben; Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung waren wichtig.
- Vermeidung von Gesprächen über die Krankheit: Bei vielen Paaren wurde das Thema Parkinson vermieden – vielleicht, um „Normalität” zu bewahren oder Stress zu vermeiden.
Stadiumspezifische oder mit dem Fortschreiten der Krankheit verbundene Phänomene
Die Studie ergab auch, dass verschiedene Stadien der Parkinson-Krankheit zusätzliche Dynamiken mit sich brachten:
- In früheren Stadien (wenn die Unabhängigkeit noch relativ erhalten ist) leugnen oder minimieren einige Paare die Krankheit („wir sprechen nicht darüber”, „wir tun so, als wäre es nichts”).
- In fortgeschritteneren Stadien wurde häufiger eine emotionale Distanzierung oder eine Verringerung der emotionalen Bindung beobachtet (z. B. können sich Partner aufgrund der Belastung oder der veränderten Rollen emotional zurückziehen).
- Selbst wenn die Krankheit „kaum Auswirkungen auf die Unabhängigkeit“ hatte, berichteten der PD-Patient und sein Partner von erheblichen Auswirkungen auf ihre Beziehungsdynamik und ihr emotionales Wohlbefinden.
Implikationen
- Die Studie zeigt, dass bereits in frühen Stadien der Parkinson-Krankheit die Beziehungsdynamik erheblich beeinträchtigt ist – nicht erst, wenn die Mobilität oder die kognitiven Fähigkeiten stark eingeschränkt sind.
- Da Bewältigungsstrategien (z. B. Vermeidung, Verleugnung, mangelnde Kommunikation) zu Spannungen, negativen Emotionen und möglicherweise einer schlechteren Beziehungsanpassung führen können, schlagen die Autoren vor, dass Unterstützungsmaßnahmen auf beide Partner (die Person mit Parkinson und den Ehepartner) ausgerichtet sein und frühzeitig beginnen sollten.
- Medizinisches Fachpersonal sollte auf Veränderungen in der Funktionsweise der Paarbeziehung (Kommunikation, emotionale Bindung, Rollenverschiebungen) achten und die Unterstützung entsprechend anpassen.
Kurz gesagt
- PD betrifft nicht nur die Person mit der Diagnose, sondern verändert das Leben des Paares.
- Wichtige Beziehungsmechanismen: unterschiedliche Wahrnehmungen der Krankheit, Bemühungen, zusammenzubleiben, und oft das Vermeiden von Gesprächen über die Krankheit.
- Diese Dynamiken sind in allen Stadien vorhanden, entwickeln sich jedoch mit fortschreitender Parkinson-Krankheit weiter.
- Eine frühzeitige psychologische und beziehungsbezogene Unterstützung für beide Partner ist wichtig für eine gesunde Anpassung.
Ausgewählte und kommentierte Zitate
Hier sind einige ausgewählte Zitate von Teilnehmern und reichhaltige kontextbezogene Auszüge aus der Studie „Wenn die Parkinson-Krankheit das Leben eines Paares beeinträchtigt: Eine qualitative Studie” (Dujardin et al., 2025), die veranschaulicht, wie Paare die Auswirkungen der Parkinson-Krankheit (PD) auf ihre Beziehung erleben. Die Zitate sind nach Themen gruppiert und mit Kommentaren versehen, wie sie für die klinische oder relationale Unterstützung hilfreich sein können.
1. Unterschiedliche Ansichten über die Krankheit
„Er sieht es als ‚nur ein bisschen Älterwerden‘, ich sehe es als ‚etwas, das unsere Zukunft verändert‘.“
(Partner einer Person mit PD)
Kommentar:
Dies veranschaulicht, wie ein Partner die Krankheit herunterspielen kann (z. B. als „nur Älterwerden“), während der andere sie als bevorstehende große Veränderung wahrnimmt. Diese unterschiedlichen Sichtweisen können zu emotionaler Distanz oder Frustration führen: Ein Partner fühlt sich möglicherweise nicht gehört oder nicht ernst genommen. Die Studie hebt diese Divergenz als zentralen Mechanismus in der Anpassung von Paaren hervor.
Implikation für die Praxis: Kliniker, die mit Paaren arbeiten, sollten untersuchen, wie jeder Partner die Krankheit einordnet, Unstimmigkeiten identifizieren und eine gemeinsame Sprache/Bedeutung für das Geschehen finden.
2. Bemühungen, zusammenzubleiben/zusammenzuhalten
„Wir sagen ‚wir gegen die Krankheit‘, die Krankheit steht nicht zwischen uns – wir stehen das gemeinsam durch.“
(Parkinsonerkrankter)
Kommentar:
Diese Art der „Wir-als-Team“-Einstellung erscheint in der Studie als eine adaptive Beziehungshaltung. Das Paar definiert sich bewusst als ein Team, das sich gemeinsam der Parkinson-Krankheit stellt, anstatt sich in „Patient/Pflegekraft“ aufzuteilen. Dies trägt zur Resilienz bei.
Implikation für die Praxis: Interventionen könnten dieses Modell der gemeinsamen Identität („wir“) verstärken: Förderung gemeinsamer Entscheidungen, gegenseitige Unterstützung, sogar gemeinsame Ziele trotz der Krankheit.
3. Vermeidung von Diskussionen über die Krankheit
„Wenn wir nicht darüber sprechen, müssen wir uns nicht hilflos fühlen.“
(Partner einer Person mit Parkinson)
Kommentar:
Vermeidung wurde häufig berichtet – Partner nennen die Krankheit möglicherweise nicht beim Namen und weichen Diskussionen darüber aus, wie sich das Leben verändern wird. Dies mag zwar kurzfristig als Schutzmechanismus dienen, führt jedoch laut den Autoren oft zu Spannungen und einer nicht anerkannten emotionalen Belastung.
Implikation für die Praxis: Die Unterstützung sollte Paare behutsam zu einer offenen Kommunikation hinführen – ohne sie zu schweren Diskussionen zu zwingen, sondern indem ein sicherer Raum geschaffen wird, in dem sie ihre Ängste, Hoffnungen und Rollenveränderungen zum Ausdruck bringen können.
4. Leugnen und Verharmlosen im Frühstadium
„Wir fahren immer noch wie früher in den Urlaub – also hat sich nichts geändert, oder?“
(Person mit Parkinson im Frühstadium)
Kommentar:
In früheren Krankheitsstadien verhalten sich Paare möglicherweise so, als hätte sich wenig geändert, selbst wenn subtile Symptome vorhanden sind. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein solches Verharmlosen oder Leugnen eine Bewältigungsstrategie ist – aber die emotionale Anpassung oder Planung verzögern kann.
Implikation für die Praxis: Selbst wenn die Selbstständigkeit noch hoch ist, sollten Ärzte sensibel relationale/psychologische Probleme ansprechen, anstatt davon auszugehen, dass „alles in Ordnung ist“.
5. Emotionale Distanzierung in fortgeschrittenen Stadien
„Früher habe ich ihm alles erzählt, jetzt tue ich das nicht mehr, weil ich befürchte, dass er sich dann noch mehr Sorgen macht als ich.“
(Partner einer Person mit Parkinson im fortgeschrittenen Stadium)
Kommentar:
In späteren Stadien treten emotionale Entfremdung oder Rückzug häufiger auf. Der pflegende Partner unterdrückt möglicherweise seine eigenen Emotionen, um den anderen nicht zu belasten; die Person mit Parkinson zieht sich möglicherweise aus Scham oder Frustration zurück. Die Studie fasst dies als einen Mechanismus der Beziehungsänderung zusammen.
Implikation für die Praxis: Helfen Sie Paaren, solche Rückzugsverhalten zu erkennen, und fördern Sie die Wiederannäherung durch gemeinsame sinnvolle Aktivitäten oder indem Sie den emotionalen Ausdruck jedes Partners unterstützen.
6. Emotionale Belastung trotz erhaltener Unabhängigkeit
„Er kann noch laufen und Auto fahren, aber ich habe das Gefühl, dass ich hinter den Kulissen schon so viel zu bewältigen habe.“
(Ehepartner einer Person mit Parkinson im frühen/mittleren Stadium)
Kommentar:
Dies unterstreicht eine wichtige Erkenntnis: Selbst wenn die Person mit Parkinson ihre Unabhängigkeit behält, ist die Beziehungsdynamik bereits verändert – versteckte Aufgaben, vorweggenommene Ängste, Rollenverschiebungen. Die Autoren betonen, dass „Parkinson selbst bei geringen Auswirkungen auf die Unabhängigkeit die Dynamik des Paares erheblich beeinflussen kann“.
Implikation für die Praxis: Beratung/Unterstützung sollte nicht erst bei nachlassender Mobilität oder kognitiven Fähigkeiten erfolgen – frühzeitige Beziehungsänderungen sind wichtig.
7. Durch Anpassungsstrategien entstehende Spannungen
„Wenn ich versuche zu helfen, wehrt er sich, dann fühle ich mich nutzlos – und er fühlt sich schuldig. Am Ende schweigen wir beide.“
(Ehepartner)
Kommentar:
Anpassungsstrategien (helfen, Hilfe ablehnen, Gefühle verbergen) führen oft zu unausgesprochenen Spannungen, Schuldgefühlen und Schweigen. Die Studie berichtet, dass bei den meisten Paaren „Strategien zur Anpassung … zu Spannungen und negativen Emotionen führen“.
Implikation für die Praxis: Die Unterstützung sollte sich nicht nur auf „das, was zu tun ist“ (z. B. praktische Hilfe) konzentrieren, sondern auch auf die emotionalen Auswirkungen auf die Beziehung – Schuldgefühle, Verlust der Gleichberechtigung, Rollenverschiebungen, Identitätswandel.
Praktische Vorschläge für die Paartherapie/klinische Praxis
- Frühzeitige Untersuchung: Bewerten Sie die Kommunikation des Paares, die emotionale Verbindung und die gegenseitigen Bedeutungen im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit – auch wenn die körperlichen Symptome mild sind.
- Moderierte Gespräche: Schaffen Sie geführte Dialoge für Paare, um zu erkunden, wie jeder Partner die Krankheit sieht, was er befürchtet und was er sich erhofft.
- Verstärkung der „Wir“-Sprache: Ermutigen Sie Paare, eine „gemeinsame Reise“-Denkweise anzunehmen und beizubehalten, anstatt in eine Dichotomie zwischen Patient und Pflegeperson zu verfallen.
- Anerkennung von Rollen: Erkennen Sie Rollenveränderungen an (z. B. wenn der Partner mehr zum Helfer/Manager wird) und unterstützen Sie die Neuverhandlung der Beziehungsbalance, Identität und Intimität.
- Umgang mit Vermeidung: Fordern Sie sanft dazu auf, Diskussionen über die Krankheit nicht zu vermeiden – nicht, um eine Überlastung zu erzwingen, sondern um einen sicheren Raum für den Austausch von Emotionen zu schaffen.
- Unterstützung für den nicht von Parkinson betroffenen Partner: Der Ehepartner/Partner trägt oft eine Last, auch wenn er dies still für sich behält. Bieten Sie speziell für ihn Ressourcen und Psychoedukation an.
- Zeitpunkt: Interventionen sollten nicht erst bei offensichtlichem körperlichem Verfall erfolgen – Beziehungsänderungen beginnen frühzeitig.
Leider stehen keine ausführlichen wörtlichen Zitate aus dem Volltext der Studie „When Parkinson’s disease interferes in a couple’s life: A qualitative study” von Kathy Dujardin et al. zur Verfügung, da der Volltext hinter einer Paywall des Verlags steht und der Inhalt urheberrechtlich geschützt ist.